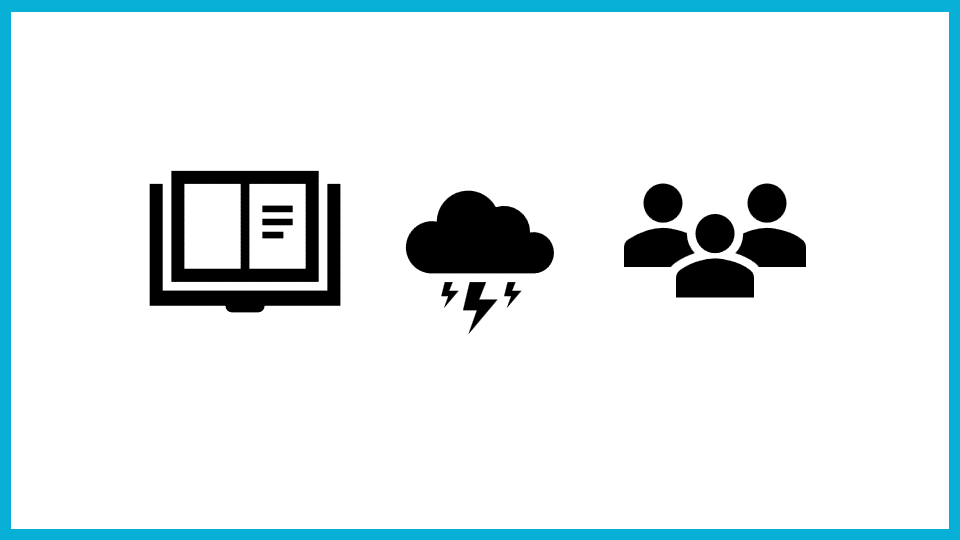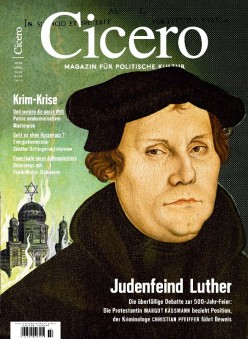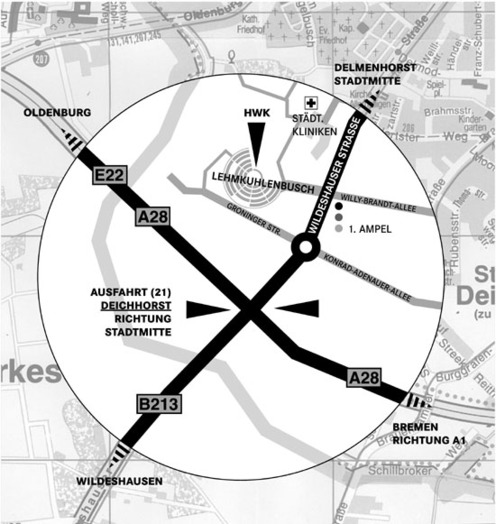In einem seiner kontroversesten Texte erweckt Stefan George den Anschein, dass ein Heiliger Krieg Gedichte als Inspiration beanspruchen darf. Macht sich George in diesem Gedicht aus dem Stern des Bundes zum Anwalt eines Massenmordes?
Ihr baut verbrechende an maass und grenze:
‚Was hoch ist kann auch höher!‘ doch kein fund
Kein stütz kein flick mehr dient .. es wankt der bau.
Und an der weisheit end ruft ihr zum himmel:
‚Was tun eh wir im eignen schutt ersticken
Eh eignes spukgebild das hirn uns zehrt?‘
Der lacht: zu spät für stillstand und arznei!
Zehntausend muss der heilige wahnsinn schlagen
Zehntausend muss die heilige seuche raffen
Zehntausende der heilige krieg.
Dieses Gedicht ist ein starkes Stück – ein so starkes, dass es ihm gegenüber fast keine wohlmeinenden Leser geben kann. Wie sollte man Verständnis haben für die Prophetien der Schlusszeilen mit ihrer dreifachen Anapher, mit der dreifachen Anrufung des Heiligen, mit dem zusammengezwungenen letzten Vers? Mit welcher Berechtigung sollte man glauben, dass man in der vorausgesagten großstädtischen Hekatombe nicht einer der Zehntausenden sein wird? Warum sollte man sich überhaupt mit einem Gedicht auseinandersetzen, dass mit einem so anklagenden Ton ansetzt und eine unspezifizierte, große Gruppe moderner Menschen als Verbrecher bezeichnet?
Die Vorbehalte zerstreuen sich auch nach wiederholter Lektüre kaum. George kritisiert hier und andernorts die Grundlagen der Moderne – ihre Fixierung auf Wachstum, Anstrengung und Rekorde, ihre Lust am Tabubruch, an der Grenzüberschreitung, ihr Kokettieren mit der Maßlosigkeit, ihre Tendenz, Beschränkung und Zufriedenheit als selbstverschuldete Unmündigkeit zu brandmarken, und von ihren Errungenschaften ist hier nicht die Rede.
Wer umfassend kritisiert, wird sich die Frage nach einer umfassenden Alternative stellen müssen, und er wird dann weiterfragen müssen, wie man denn von A nach B kommt – durch welche grundstürzenden Veränderungen. In gewisser Weise umgeht der Stern diese Frage: Er führt dem Leser im Zweiten und Dritten Buch vor Augen, dass grundlegende Veränderungen eher aus der vertraulichen Innigkeit eines Freundespaares erwachsen als aus einem heiligen Krieg. Der vorausgesagte Krieg findet im Stern des Bundes nicht statt. Und wie man vom Ersten zum Zweiten Buch gelangt, also von der Zeitkritik zum vertrauten Bund, und wie vom Zweiten zum Dritten, also vom vertrauten Bund zur gestaltungsfähigen Gemeinschaft, bleibt ebenfalls offen.
Mit dem Hinweis darauf, dass der Krieg im Stern letztlich doch nicht stattfindet, ist das Gedicht aber nicht erledigt. Ein Gedicht kann nicht, wie ein Argument, durch ein anderes widerlegt werden. Es lässt sich nicht ungesagt machen, und George wollte sich auch ganz offenbar nicht davon distanzieren.
Das Gedicht ist eine kleine Szene. Es gibt neben dem Sprecher zwei weitere Sprecherinstanzen: die Gruppe der Angeklagten und den abseits stehenden, nur mit einem Demonstrativpronomen bezeichneten Warner. Die Anklage lautet, dass die Beklagten ihren Größenwahn soweit vorangetrieben haben, dass ihre Bauwut das Gebaute selbst destabilisiert. Sie haben das offenbar erkannt, denn erstens sind sie schon dabei zu versuchen, die Mängel ihres Werks auszubessern, und zweitens können sie kaum übersehen, dass ihr Werk „wankt“, also bald zusammenstürzen wird.
Von nun an geschieht alles in Zeitlupe. Die Szene verlangsamt sich. Der Bau wankt schon, aber erst „an der weisheit end“, also nach einer zumindest als lang empfundenen Zeitspanne, beginnen die Baumeister zu beten. Sie gehen weiterhin davon aus, dass noch Zeit zu handeln ist, sehen aber schon ein, dass ihr Handeln den Zusammenbruch nicht aufhalten kann. Sie sehen schon, dass das Gebäude zu „schutt“ werden wird und dass es ohnehin nicht viel mehr war als ein „spukgebild“. Sie fürchten, dass sie körperlich versehrt werden und dass ihr eigenes Denken, ihre kritische Erkenntnisfähigkeit Schaden nimmt.
In diesem Moment beginnen die vom Gedicht Angesprochenen furchtsam zu beten. Ihnen antwortet nicht der Sprecher des Gedichts, sondern ein weiterer Anwesender, vielleicht der Angerufene am Himmel. Er geht auf die doppelte Furcht ein: Die materielle Katastrophe ist nicht aufzuhalten, es gibt keinen „stillstand“; der geistige Niedergang ist außerdem endgültig, es gibt keine „arznei“. Für die modernen Baumeister vergeht die Zeit langsamer (für sie gibt es noch ein „eh“) als für den entrückten Warner, der ihnen ein „zu spät“ entgegenruft. Er ist es nun, der der Beschleunigung (des Zusammenbruchs) das Wort zu reden scheint.
Vier Fragen stellen sich: Wer ist dieser Warner? Zu wem spricht er? Welchen Stellenwert hat seine Äußerung? Und wie verhält sich das Vorhergesagte zu dem Vorausgegangenen? Die Fragen hängen zusammen.
Diese Fragen verfolge ich in meinem Aufsatz zu dem Gedicht weiter. Er steht auf den S. 362 bis 367 in diesem Buch.
Hrsg. von Christophe Fricker
488 Seiten. Kt 49,00 €
ISBN 978-3-465-04328-7
Klostermann
Das Abendland N.F. 41