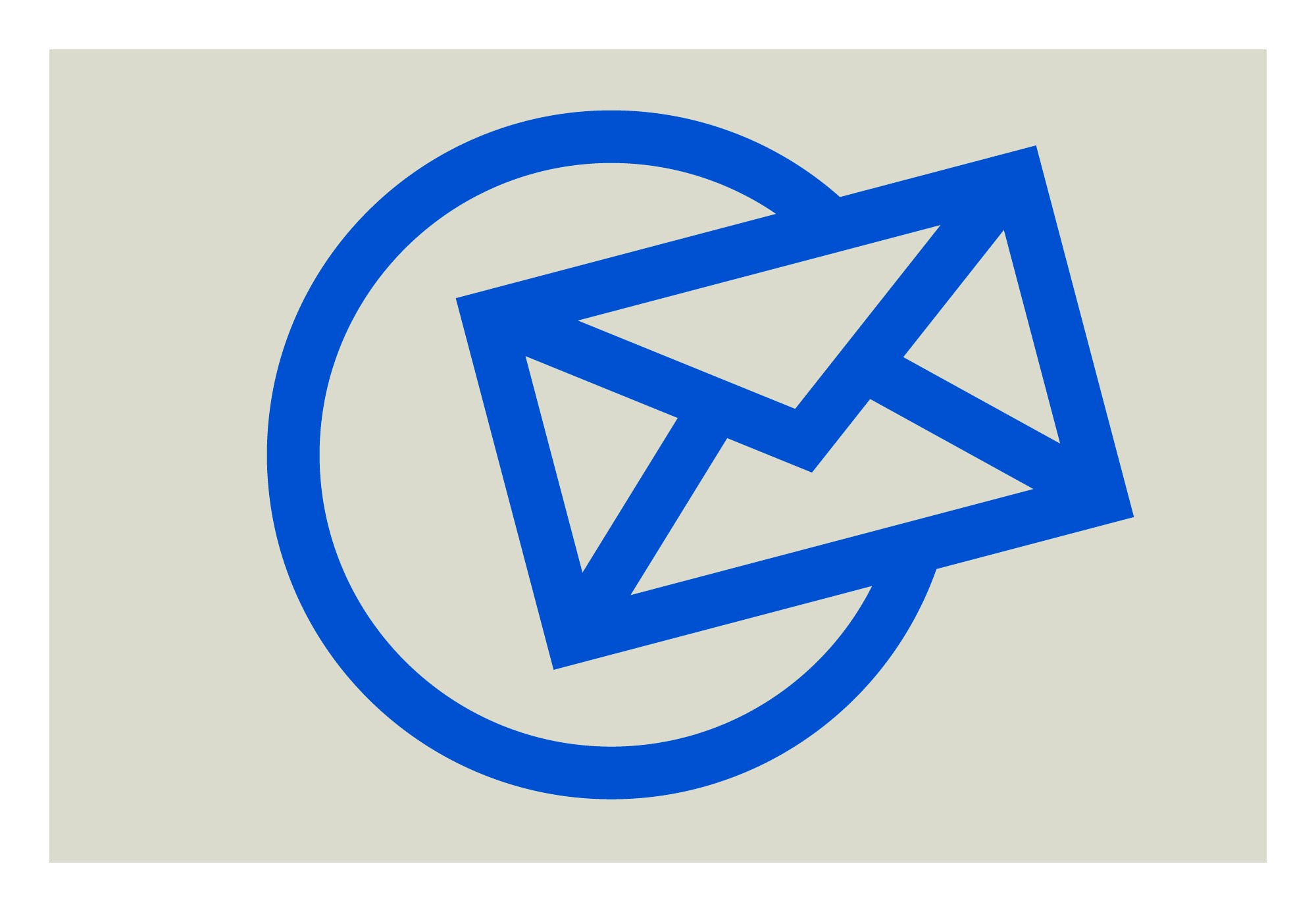Tomas Tranströmers Schubertiana ist eines der bemerkenswertesten Gedichte der letzten Jahrzehnte. Es beginnt in der Nähe von New York:
Im Abenddunkel auf einem Platz außerhalb von New York, ein Aussichtspunkt, von dem aus man mit einem einzigen Blick die Wohnungen von acht Millionen Menschen umfassen kann.
Die Riesenstadt in der Ferne dort ist eine lange glitzernde Wehe, ein seitlich gesehener Spiralnebel.
Drinnen im Spiralnebel werden Kaffeetassen über die Theke geschoben, die Schaufenster betteln die Vorbeigehenden an, ein Gewimmel von Schuhen, die keinerlei Spuren hinterlassen.
Tomas Tranströmer, Schubertiana (Anfang)
Mit dem ersten Vers wird klar, was auch die weitere Lektüre prägen muss: Dies ist kein Gedicht über Schubert. Wer ein Gedicht über den Wiener Komponisten erwartet hatte, hat wohl schon den Titel nicht zuende gelesen: „Schubertiana“. Nicht: „Schubert“.
Wo es um Schubert geht (auf Gemälden, in Filmen, bei Vorträgen), steht ein Mensch im Mittelpunkt, der trotz seiner Welt und für seine Welt Musik schrieb. Er brachte Musik in die Welt, und dafür liebt ihn die Genieästhetik, die auch gleich weiß, dass Salieri, die kaiserliche Hofkapelle, die großen Verleger und der noch größere Goethe das Genie verkennen mussten. Goethe war übrigens fünfzig Jahre älter als Schubert und hat ihn noch überlebt. Aber darum geht es hier nicht.
Es geht bei Tranströmer auch nicht um Schubert. Bei Tranströmer ist der erste Ort der Handlung nicht das Dreimäderlhaus, sondern ein Aussichtspunkt hier in Newark, in der Welt der Vorfälligkeitsentschädigungen und der Kämpfe um Opt-out-Regeln, nicht in der guten, alten Zeit. In diese Welt kommt Musik nicht durch Schubert; Schuberts Musik ist schon da. Aber der Künstler fehlt. Machen wir uns keine Illusionen.
Und der Autor fehlt auch: Tomas Tranströmer ist tot. Selbst als er noch lebte, hatten wir durch seine Gedichte nicht ihn, sondern vor allem uns. Der zwar schön klingende, aber inhaltlich trockene Gedichttitel „Schubertiana“ bedeutet: Erinnerungen und Imaginationen, Reliquien und Abbilder, Werke und Aufführungen, die mit einem Künstler zu tun haben, stehen in unserer eigenen Welt, sprechen zu uns. Ihr Urheber tut das nicht mehr. In die Liste dessen, was uns bleibt, gehören bei einem Dichter auch Übersetzungen. Ich lese „Schubertiana“ auf Deutsch. Vom Wort des Dichters ist das schwedische Gedicht durch seinen Sprecher entfernt; zwischen diesem und mir steht die Stimme des deutschen Übersetzers, Hanns Grössel. „Schubertiana“ gehört zu den Tranströmeriana – die Worte haben mit Tomas Tranströmer zu tun, aber wir können sie nicht ohne Weiteres an ihn zurückbinden. Und sie sprechen uns an.
So fühlbar abwesend, dass man sein Fehlen beinahe übersieht, ist auch der Sprecher des Gedichts. Wir erfahren nicht, wer denn da „im Abenddunkel auf einem Platz außerhalb von New York“ steht und auf die Stadt herunterschaut. Sicher kann „man“ diese Perspektive einnehmen, aber die ebenso eindringliche wie ungewöhnliche Beschreibung des Gesehenen verleitet zu dem Schluss, dass jemand Bestimmtes dort oben jetzt tatsächlich stehen muss. Vielleicht ja wir. Ich.
Oder Sie.
Dieser Vermutung gehe ich in einem langen Essay über Tomas Tranströmers Schubertiana nach, das in der Zeitschrift L. Der Literaturbote erschienen ist. Ich lade Sie ein, mir zu folgen!
„Trügerische Ruhe. Eine Reise durch die Welt der Lichter und der Worte mit Tomas Tranströmers ‚Schubertiana.’“ L. Der Literaturbote 121 (2016): 4-24.